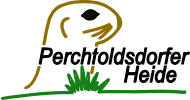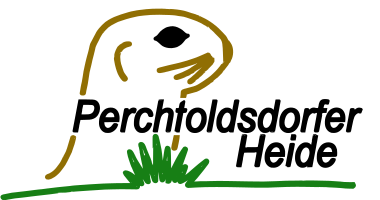Heute Abend versammelten sich 40 Naturbegeisterte im Weinbaugebiet der Marktgemeinde Perchtoldsdorf, um gemeinsam mit Biologin Irene Drozdowski und Ökologe Alexander Mrkvicka die Vielfalt des Perchtoldsdorfer Gemeindewaldes zu entdecken. Ergänzt wurde die Exkursion durch Gemeindeförster Stefan Jeitler, der weitere spannende Einblicke in den Wald bot.
Der Perchtoldsorfer Wald weist in seinem Untergrund und seiner Geologie eine hohe Vielfalt auf. Wo früher ausgedehnte Weideflächen lagen, entwickelten sich lichte Schwarzföhrenwälder (Pinus nigra), die heute charakteristisch für das Gebiet sind. Mit den steigenden Temperaturen und der zunehmenden Trockenheit infolge des Klimawandels geraten diese Wälder jedoch zunehmend unter Druck. Andere Waldtypen, wie etwa Eichenwälder, zeigen sich zum Teil besser an diese Veränderungen angepasst. Ein Energiekonzept und eine Standortskartierung des Waldes nach Waldtypen sowie dessen Zuwachs wurden in diesem Rahmen erarbeitet. Heute stehen vor allem die hohe Bedeutung des Waldes als Erholungsgebiet sowie seine Klimawirkung durch die Evapotranspiration auf die angrenzenden Siedlungsbereiche im Vordergrund.
Die Exkursion führte die Teilnehmer:innen zunächst entlang des Waldsaumes und der angrenzenden Weinbaugebiete – begleitet von der Schwärzlichen Flockenblume (Centaurea nigrescens), die vor allem in den Übergangsbereichen zwischen Wald und Offenland vorkommt und in Österreich nur in Ostösterreich sowie in Kärnten verbreitet ist. Anschließend ging es weiter in den Kardinalgraben und hinauf entlang seines Kammes aus Dolomitgestein. Im Zuge der Kartierung wurde dieser ökologisch besonders wertvolle Teil des Perchtoldsdorfer Waldes als Naturwaldreservat ausgewiesen. Die Naturinteressierten konnten viel über die Bedeutung von absterbenden Bäumen und von Totholz als Lebensraum für bedrohte Arten wie den Hirschkäfer (Lucanus cervus) und der Alpenbock (Rosalia alpina) erfahren.
Am Kamm entlang ließ sich eindrucksvoll der Zusammenhang zwischen Licht, Hangneigung und deren Einfluss auf die Ausprägung der Waldtypen beobachten: von südseitig stehenden Eichen- und Föhrenwäldern, stellenweise mit Linden, bis hin zu schattig gelegenen Buchenwäldern. Gemeinsam mit den an den trockeneren und sonnigeren Hängen wachsenden Sträuchern, wie etwa dem Dirndlstrauch (Cornus mas), bilden sie einen wichtigen Schutzwall gegen Erosion. Vereinzelt konnten wir auch die bei uns seltene Pimpernuss (Staphylea pinnata) bewundern. Die Teilnehmer:innen erhielten außerem spannende Einblicke in die Vielzahl der Organismen, die auf Eichen leben – insbesondere in die Gruppe der Gallwespen und die von ihnen gebildeten Pflanzengallen.
Nachdem die Naturinteressierten den Kamm erfolgreich erklommen hatten, führte der Weg an den Forschungsprojektflächen für Waldentwicklung und Biodiversität des BVW Connect vorbei. Dabei handelt es sich um wirtschaftlich ungenutzte Waldflächen mit besonderer Zusammensetzung und hoher ökologischer Bedeutung. Sie dienen als Waldtrittsteine für seltene und anspruchsvolle Arten wie Schwarzspecht (Dryocopus martius), Mittelspecht (Leiopicus medius), Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) sowie Waldkauz (Strix aluco) und Uhu (Bubo bubo). Diese Arten sind auf reichlich Totholz und die darin vorkommenden Insekten angewiesen. Durch Bilder und Präparate wurde den Teilnehmer:innen die Vielfalt des Waldes noch anschaulicher vermittelt.
Oben angekommen präsentierte sich der primäre Schwarzföhrenwald mit seinen schirmförmigen Kronen in einem ganz anderen Erscheinungsbild als der restliche Wald. Im Unterwuchs entfaltete sich ein Trockenrasen mit einer bunten Mischung aus Berglauch (Allium lusitanicum), Duftskabiose (Scabiosa canescens) und Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea).
Am Ziel der Exkursion, der Kammersteinhütte, wurden alle mit der untergehenden Sonne und einem wunderschönen Ausblick über den Wienerwald und die Stadt Wien belohnt.
Annette Peters, Praktikantin des Landschaftspflegevereins