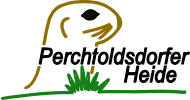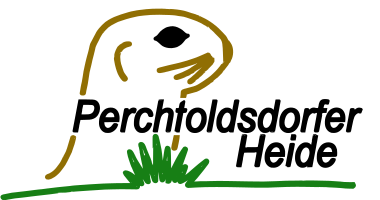Die Perchtoldsdorfer Heide ist eine Kulturlandschaft und zum großen Teil nicht natürlichen Ursprungs, sondern durch den Menschen entstanden. Das verringert aber nicht ihren hohen Wert als Landschaft und Lebensraum – ganz im Gegenteil, Trockenrasen gehören zu den Hotspots der Artenvielfalt in Österreich!
Die Perchtoldsdorfer Heide liegt am Ostabhang des Wienerwaldes an der Thermenlinie. Da an der Thermenlinie die Alpen und der pannonischem Raum aufeinander treffen und man hier Arten aus beiden Naturräumen, aber auch aus dem Submediterran-Raum findet, ist die Thermenlinie eines der vielfältigsten und artenreichsten Gebiete Österreichs, ja sogar Mitteleuropas.
Trocken- und Halbtrockenrasen sind gemeinsam mit Flüssen und Mooren die ältesten natürlichen Lebensräume des pannonischen Gebietes. An der Thermenlinie kommen Trockenrasen vor allem in felsigen Hangbereichen mit geringer Bodenauflage vor. Zwischen diesen Trockenrasen stehen oft lichte, artenreiche Wälder mit Flaum-Eichen oder Schwarz-Föhren. Viele in der heutigen Zeit seltene trockenheitsertragende Pflanzen und Tiere waren früher im Wiener Becken und an der Thermenlinie viel weiter verbreitet. Sie sind Reste des eurasischen Steppengürtels, der in den letzten Eiszeiten (vor ca. 600.000 bis 11.000 Jahren) vom pannonischen Raum bis zum Tian-Shan-Gebirge in China reichte und von großen wildlebenden Pflanzenfressern wie Mammut, Wisent oder Auerochs beweidet wurde. Mit der Besiedelung und landwirtschaftlichen Nutzung der Region ab der Jungsteinzeit vor ca. 7600 Jahren durch unsere Vorfahren ersetzten deren Weidetiere zunehmend die großen Pflanzenfresser. Ausgedehnte Trocken- und Halbtrockenrasen wurden durch die Weidenutzung über Jahrtausende waldfrei gehalten. Erst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde die Beweidung durch den Wandel der Landwirtschaft vielfach aufgegeben. Die Trocken- und Halbtrockenrasen gingen in ganz Österreich stark zurück. Große Teile wurden sich selbst überlassen und wieder zu Wald, aktiv aufgeforstet oder durch Steinbrüche und Verbauung zerstört.
Neben den Feuchtgebieten gehören Trockenrasen heute zu den am meisten gefährdeten Lebensräumen. In Österreich beträgt ihr Flächenanteil nur noch circa 0,018% (weniger als 2 Zehntausendstel!) des Bundesgebietes, umgerechnet also nur 17 km²! Zum Vergleich: Die Fläche des Ortsgebietes von Perchtoldsdorf beträgt 12 km². An der Thermenlinie waren nach einer aktuellen, noch unveröffentlichten Studie des Biosphärenpark Wienerwald 2008 nur mehr knapp 72 Hektar Trocken- und Halbtrockenrasen zu finden. Die winzigen Überreste von einst vielen hundert Hektar Fläche! Die Perchtoldsdorfer Heide ist dabei aktuell die größte zusammenhängende und nach Naturschutzzielen bewirtschaftete und gepflegte Trockenrasen- und Halbtrockenrasenfläche an der Thermenlinie!
Was ist ein Trockenrasen?
Trockenrasen sind Gras- und Kräuterbestände, die durch Trockenheit und geringen Nährstoffgehalt des Bodens geprägt werden. Trockenrasen sind auf der Heide vor allem auf Hügelkuppen, Ebenen und Südhängen zu finden, wo Felsen aus Dolomitgestein aus dem Untergrund hervortreten oder nur ganz wenig Boden über dem Gestein liegt. Wo der Boden tiefgründiger oder lehmiger ist, und Wasser besser speichern kann, gibt es Halbtrockenrasen. Trocken- und Halbtrockenrasen sind durch Jahrtausende lange Beweidung geprägt und würden ohne Nutzung und Pflege verbuschen und sich zum Wald entwickeln, wie man es im eingezäunten Naturschutzgebiet auf der Kleinen Heide oder einer Versuchsfläche im Zieselschutzgebiet auf der Großen Heide deutlich beobachten kann.
Wo der Boden tiefgründiger ist, findet man auf der Heide die sekundären Trockenrasen und Halbtrockenrasen. Sie sind durch Rodung und jahrtausendelange Beweidung entstanden und würden ohne Nutzung und Pflegemaßnahmen in wenigen Jahren verbuschen und sich zum Wald entwickeln, wie man es im eingezäunten Naturschutzgebiet auf der Kleinen Heide deutlich beobachten kann.
Seltene Tiere und Pflanzen
Mit den harten Lebensbedingungen, die in einem Trockenrasen herrschen, kommen nur speziell angepasste Pflanzen und Tiere zurecht. Einen bedeutenden Anteil der Vegetation bilden verschiedene Arten von niedrigwüchsigen Gräsern. Um Austrocknung zu vermeiden, besitzen sie oft sehr harte, schmale Blätter, die bei manchen Arten noch zusätzlich eingerollt sind. Sie treiben keine weitreichenden Ausläufer, wie es jene Gräserarten tun, die für einen Rasen in Gärten angepflanzt werden. Stattdessen stehen die Grashalme in dichten Büscheln, so genannten Horsten zusammen, in denen sich die Feuchtigkeit besser halten kann. Zusätzlich sind die einzelnen Halme in einem dichten Horst dem Wind und der Sonneneinstrahlung weniger ausgesetzt.
Zwischen den Gräsern findet man eine Vielzahl krautiger Pflanzen, aber auch immer wieder Stellen mit offenem, vegetationsfreiem Boden. Einige Pflanzenarten wie etwa die extrem seltene Pannonische Wolfsmilch oder die Zwergschwertlilie benötigen diese offenen Stellen, da sie dort keine Konkurrenz durch andere Pflanzen erfahren und nur so überleben können.
Andere Trockenrasenpflanzen wie zum Beispiel die Kuhschelle haben als Schutz vor der hohen Sonneneinstrahlung eine starke Behaarung auf Blättern und Stängeln gebildet, durch die Lichtstrahlen reflektiert und die Verdunstung verringert werden. Zerteilte, gefiederte oder geschlitzte Blätter sowie Polsterwuchs schützen ebenfalls vor übermäßiger Verdunstung.
Eine weitere Strategie, um Trockenperioden zu überleben, ist das Absterben der oberirdischen Pflanzenteile nach der Blüte und Überdauern der Pflanzen im Boden mit Hilfe von Wasser speichernden Organen. Beispiele dafür sind einige heimische Orchideenarten oder verschiedene Laucharten. Manche Arten sind überhaupt nur einjährig, sterben nach der Blüte ab und überdauern die Trockenperiode als Samen.
Geringes Nährstoffangebot
Aus der Gärtnerei und Landwirtschaft hören wir immer wieder, dass Pflanzen viele Nährstoffe brauchen, um gesund zu wachsen. Dies trifft jedoch im Fall der Trockenrasenpflanzen in keiner Weise zu. Sie haben sich an das niedrige Nährstoffangebot angepasst, indem sie es effizienter nützen, eher kleinwüchsig bleiben und nur sehr langsam wachsen. So benötigt ein Horst der Erd-Segge mehrere Jahre, um einen Durchmesser von 10 cm zu erreichen. Größere Mengen von Nährstoffen bringen den Trockenrasenpflanzen keinen Vorteil, da sie das erhöhte Angebot nicht nützen können.
Ein Überschuss an Nährstoffen ist sogar eine große Gefahr für einen Trockenrasen. Häufige Pflanzen wie zum Beispiel die Brennessel oder der Gewöhnliche Beifuß können die Nährstoffe besser verwerten und überwuchern den Trockenrasen. Auf der Perchtoldsdorfer Heide ist in manchen Bereichen die Überdüngung durch den Hundekot ein Problem. Der Schafkot hingegen wirkt gut verteilt nicht als Dünger, da die Schafe nicht zugefüttert werden dürfen und den Pflanzen, die sie fressen viele Nährstoffe entziehen.
Spezielle Anpassungen
An die Eigenheiten der Trockenrasenvegetation haben sich viele Tierarten angepasst, die nur in Trockenrasen zu finden sind. Der große Blütenreichtum bietet unzähligen Kleintieren, vor allem Insekten Nahrung. Wildbienen, Schmetterlinge, Fliegen und Käfer sammeln Nektar und Pollen. Unter den 74 bisher nachgewiesenen Tagfalterarten der Heide sind Schwalbenschwanz und Segelfalter die auffälligsten. Schmetterlingsraupen und verschiedenste Heuschreckenarten fressen – oft hoch spezialisiert auf bestimmte Arten – ganze Pflanzenteile. Wanzen und Zikaden dagegen stechen mit ihrem Rüssel ebenfalls oft ganz bestimmte Pflanzen an und saugen den nahrhaften Saft. Gut getarnt – ja sogar zum Teil an die Blütenfarbe angepasst – warten auf den Pflanzen verschiedenste Räuber auf ihre Beute, darunter Gottesanbeterin, Sägeschrecke, Krabbenspinne und Steirische Fanghaft. Auch am Boden sind Räuber wie die Rote Röhrenspinne auf Beutefang. Aber auch im Flug jagende Räuber sind unterwegs – der Schmetterlingshaft, ein Netzflügler, oder die Herbstmosaikjungfer, die von August bis Oktober oft in großen Schwärmen zu beobachten ist.
Von den Großinsekten leben der Neuntöter aber auch der Turmfalke und verschiedenste Fledermausarten wie der Große Abendsegler. Am Ende der Nahrungskette stehen auch die größte heimische Eidechsenart, die bunte Smaragdeidechse, die Äskulapnatter und die Schlingnatter. Das Europäische Ziesel, das für sein Überleben auf die niedrige, offene Vegetation angewiesen ist, ist ein Pflanzenfresser, nimmt aber auch ab und zu einmal einen schmackhaften Käfer.
Ein großer Teil der Tiere und Pflanzen der Perchtoldsdorfer Heide ist in Österreich oder sogar europaweit gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Es handelt sich also um große Besonderheiten, für deren Überleben wir alle Verantwortung tragen. Umso mehr sollten wir ihren Wert schätzen und uns um ihren Schutz bemühen, denn der Erhalt der Heide ist keineswegs ohne Verständnis aller Besucher und Besucherinnen möglich!